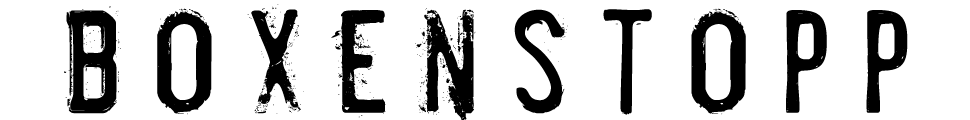Biografie Christina Pernsteiner
 Auf dem Weg zur Bildungswissenschafterin
Auf dem Weg zur Bildungswissenschafterin
Über unzumutbare Entfernungen, vertagte Entscheidungen und Plan B
Nach der Volksschule stand mir die Option Gymnasium offen, aber die fast 25 km Entfernung zum nächsten Standort schienen damals für mich und meine Familie unüberbrückbar. Also landete ich in der viel näher gelegenen Hauptschule mit Schwerpunkt Ökologie. Dort entwickelte sich meine Vorliebe für Sprachen und kreatives Gestalten weiter. So hielt ich mich häufig in der Bibliothek auf und blieb auch der Theatergruppe vier Jahre lang treu.In meiner Hauptschule wurden damals bereits einige Berufsorientierungsaktivitäten durchgeführt. So nahmen wir an einem Interessenstest teil, besuchten das nahe gelegene AMS oder konnten Löten und Feilen im Rahmen eines Technik-Workshops ausprobieren.
Die Entscheidung über meinen weiteren Bildungsweg fiel ich dann aber mehr oder wenig an jenem Abend, als die weiterführenden Schulen ihr Angebot vorstellten. Da stand der Direktor des damaligen Oberstufengymnasiums und präsentierte unter anderem den musischen Zweig: Dies sei genau das Richtige für alle, die sich für diesen Schwerpunkt interessieren, aber noch nicht genau wissen, was sie später einmal machen wollen. Dies kam mir zu diesem Zeitpunkt vernünftig vor und so hatte ich weitere vier Jahre „Schonfrist“, bevor ich mich für einen beruflichen Weg entscheiden musste.
Klar war nach dieser Zeit, dass es „nur“ mit einer AHS-Matura schwer sein würde, einen Job am Arbeitsmarkt zu finden, also bewarb ich mich auf einer Fachhochschule für Soziale Arbeit. Mit etwas naiven Weltverbesserungsvorstellungen durchlief ich das Aufnahmeverfahren, wo ich nicht unter die ersten 30 von den über 400 BewerberInnen kam. Also musste ein Plan B her und ich landete schließlich im Pädagogik/Fächerkombination-Studium auf der Karl-Franzens-Universität in Graz. Im Nachhinein war diese 2. Wahl so ziemlich das Beste, was hätte passieren können. Neben der theoretischen und praktischen Vertiefung in pädagogische Arbeitsbereiche, entwickelte sich mein Interesse für wissenschaftliches Arbeiten, Gesundheitsförderung und vor allem für die Geschlechterforschung. Ich entdeckte, wie sehr Weiblichkeit(en) und Männlichkeit(en) nicht nur auf die körperlichen Aspekten zurückzuführen sind, sondern auch auf psychosoziale Faktoren, gesellschaftliche Rollenbilder und vieles mehr. Auch die damit zusammenhängenden Fragen nach den positiven und negativen Auswirkungen ließen mich seitdem nicht mehr los.
„Aha…wenn du also keine Lehrerin wirst, was dann???“
Ein weitere Frage, die mich während der gesamten Universitätszeit begleitet hat, waren jene nach den mit dem Pädagogik-Studium verbundenen beruflichen Möglichkeiten. Typischerweise sind die Arbeitsfelder sehr vielfältig. Dennoch ist das Erste, was hier den meisten Personen in den Sinn kommt, der mit dem Studium gerade nicht in Frage kommende LehrerInnen-Beruf. Also begann meine Standardantwort meist mit den Worten „Alles andere außer Lehrerin“.
Um noch während des Studiums herauszufinden, was dieses „Andere“ sein könnte, begann ich sehr früh Praxiserfahrung in verschiedensten sozial- und heilpädagogischen Bereichen zu sammeln. So arbeitete ich über vier Jahre ehrenamtlich in einer Notschlafstelle für Frauen, war in der Betreuung von Kindern mit Behinderung und in der Lernhilfe tätig. Nach Abschluss des Studiums landete ich in der Online-Redaktion einer österreichischen Plattform für Erwachsenenbildung und entdecke wieder völlig andere pädagogische Einsatzfelder.
Angefangen hat alles mit „mut!“
Im Herbst 2008 kreuzten sich dann meine Wege mit der MAFALDA und seitdem bin ich im Bereich der geschlechterreflektierenden Bildungs- und Berufsorientierung (BBO) tätig. Wichtige Lern- und Projektmanagementerfahrungen konnte ich hier bei „mut! – Mädchen und Technik“, „Vielfalt in der Jugendarbeit leben“ oder im „TöchterTag“ sammeln. Neben der Koordination, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit liegen meine Schwerpunkte in der Entwicklung von Bildungsangeboten in Kooperation mit den Pädagogischen Hochschulen und zunehmend in der wissenschaftlichen Arbeit. So leitete ich im Frühjahr 2011 eine österreichweite Erhebung zur BBO in der Sekundarstufe I, wo 80 Schulen und ihre Umsetzung von BBO-Aktivitäten im Fokus standen.
Im Projekt BOXENSTOPP bin ich nun für die Koordination mitverantwortlich, wobei meine Schwerpunkte vor allem bei der Erhebung der IST-Analyse der teilnehmenden 9 Schulen sowie bei der Weiterentwicklung ihrer standortspezifischen Umsetzungskonzepte liegen.